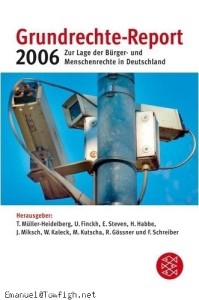 in: Till Müller-Heidelberg (Hrsg.), Grundrechte-Report 2006: Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, Fischer-Taschenbuchverlag, ISBN 3596171776, € 9,95 Buch kaufen
in: Till Müller-Heidelberg (Hrsg.), Grundrechte-Report 2006: Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland, Fischer-Taschenbuchverlag, ISBN 3596171776, € 9,95 Buch kaufen![]()
Zur Website des Grundrechte-Report
Nach der Konzeption des Grundgesetzes soll Schulbildung alle Aspekte des Lebens umfassen. Daher garantiert Art. 7 Abs. 3 GG den Religionsgemeinschaften die Einführung eines nach ihren religiösen Grundsätzen erteilten konfessionspositiven Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen. Der Unterricht wird als »ordentliches Lehrfach« unterrichtet, ganz wie Mathematik oder Fremdsprachen: er findet als Pflichtfach während der regulären Schulzeit statt, die erteilte Note ist versetzungserheblich. Die Verfassung konzipiert den Religionsunterricht als »gemeinsame Aufgabe« von Staat und Religionsgemeinschaften. Die unterrichtenden Lehrer sind in aller Regel staatlich eingestellte und besoldete Beamte, die auch andere Fächer lehren; um den Religionsunterricht bestreiten zu dürfen, benötigen sie aber eine Erlaubnis von der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Der Inhalt des Lehrplans wird von den Religionsgemeinschaften verantwortet, unterliegt aber staatlicher Überprüfung. Ein solcher Unterricht bringt sowohl dem Staat, als auch den Religionsgemeinschaften Vorteile: ersterer kann ein seinem Selbstverständnis entsprechendes umfassendes Bildungsangebot sichern, der staatlichen Neutralitätspflicht wegen wäre dies ohne die Mitwirkung der Religionsgemeinschaften nicht möglich; umgekehrt erreichen letztere einen größeren Teil ihrer Mitglieder, als bei eigener Veranstaltung eines Religionsunterrichts, und zu geringeren Kosten. Schließlich ermöglicht diese kooperative Religionspflege auch ein gewisses Maß staatlicher Kontrolle, weil der Staat Situation und Akteure aus eigener Anschauung kennt und regelmäßigen Umgang pflegt – bisweilen wird das Konzept daher auch als »Religionshege« bezeichnet.
Seit 1993 bemühen sich auch islamische Verbände um die Einrichtung islamischen Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Das zuständige Schulministerium verschleppte zunächst das Verfahren und fand später ein amorphes, sich ständig änderndes Heer von Gründen, um den Anspruch abzuwehren. Klare Anforderungen, auf die sich die Verbände hätten einrichten können, äußerte es nicht; stattdessen wurde lapidar der Satz repetiert, die Verbände seien nicht als verlässliche Partner des Staates anzusehen. 1998 erhoben schließlich zwei Dachverbände – der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland und der Zentralrat der Muslime in Deutschland – Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf. Das Gericht urteilte zugunsten des Ministeriums und befand, die klagenden Dachverbände seien nicht anspruchsberechtigt, weil sie nicht als Religionsgemeinschaften im Sinne von Art. 7 Abs. 3 GG – ein in der Verfassung nicht näher bestimmter Begriff – anzusehen seien, unter anderem weil es ihnen an einer Instanz mangele, die die Inhalte des Unterrichts verbindlich festzulegen religiös befugt sei; der Begriff der Religionsgemeinschaft erfordere eine gemeinschaftliche Verfassung mit einer demokratisch legitimierten Autorität, die von der Mitgliederbasis zur Festlegung der Inhalte des Religionsunterrichts ermächtigt sei. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster verwarf die Berufung der Kläger, weil diese als Dachverbände im Wesentlichen aus Personenvereinigungen bestünden und keine ausreichende Zahl von natürlichen Personen zu ihren Mitgliedern zählten – das aber sei begriffliche Voraussetzung für eine Religionsgemeinschaft. Darüber hinaus gebe es auf der Dachverbandsebene keinerlei religiöses Leben, vielmehr herrsche eine »vertikale Arbeitsteilung«: das praktische religiöse Leben finde bei den Mitgliedsgemeinden auf lokaler Ebene statt, die Kläger nähmen auf Dachverbandsebene dagegen lediglich organisatorische Aufgaben wahr. Dies genüge den an eine Religionsgemeinschaft zu stellenden Anforderungen nicht, und weil die Kläger daher keine Religionsgemeinschaften seien, hätten sie auch keinen Anspruch auf Einführung eines Religionsunterrichtes.
Am 23. Februar 2005 hob das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) dieses Urteil auf (Az. 6 C 2.04). Anknüpfend an einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Religionsgemeinschaft der Bahai (BVerfGE 83, 341 ff.), bestimmte das BVerwG den Begriff von seinem soziologischen Bedeutungsgehalt ausgehend. Es bestätigte damit die Auffassung der Kläger, dass Religionsgemeinschaften immer in einer aus einzelnen Gläubigen bestehenden Basis wurzeln, und dass eine mehrstufige oder arbeitsteilige Verfassung die Qualifizierung als Religionsgemeinschaft nicht ausschließt. Im Dachverbandsmodell sei die umfassende Gesamtorganisation als Religionsgemeinschaft einzustufen, ihre Untergliederungen seien Teil dieser Religionsgemeinschaft. Gleichzeitig stellte das Gericht klar, dass ein spezifisch religiöses Profil und eine institutionelle Identität erkennbar seien müssen, mithin die bloße öffentliche Repräsentation oder die Koordination der Tätigkeiten lokaler Mitgliedsgemeinden den rechtlichen Anforderungen nicht genüge; außerdem müsse der Verband verfassungstreu sein. Allerdings könne nicht verlangt werden, dass auf Dachverbandsebene eine lebendige religiöse Praxis stattfinde: Solange irgendeine religiöse Aktivität auf oberster Ebene festzustellen sei, genüge im Übrigen eine aktive religiöse Praxis in den Ortsgemeinden.
Das BVerwG hat lediglich die Kompetenz, über Rechtsfragen zu urteilen und in diesem Sinne die Maßstäbe für die Einstufung einer Vereinigung als Religionsgemeinschaft und die Voraussetzungen für die Erteilung von Religionsunterricht an öffentlichen Schulen geklärt. Über Tatsachen darf das Gericht keinen Beweis erheben, daher hat es die Sache an das OVG zurückverwiesen, das angewiesen ist, den Sachverhalt in zwei Punkten weiter aufzuklären: Erstens soll es Feststellungen darüber treffen, ob die klagenden Dachverbände über eine spezifische religiöse und institutionelle Identität verfügen; zweitens soll es klären, ob die Kläger verfassungstreue Organisationen sind. Das BVerwG hat allerdings durchblicken lassen, dass es davon ausgeht, dass die Kläger Religionsgemeinschaften sind und damit auch einen Anspruch auf Einführung islamischen Religionsunterrichts haben.
Mit seiner Rechtsprechung hat das BVerwG einmal mehr das »klassische« Verständnis vom Religionsunterricht bestätigt, und zu Recht keinen Anlass gesehen, Art. 7 Abs. 3 GG einer mit der Verfassungstradition brechenden, grundlegenden Neuinterpretation zu unterziehen. Es hat klargestellt, dass das Religionsverfassungsrecht auch für Religionsgemeinschaften offen ist, die von den etablierten Kirchen abweichende Glaubens- und Strukturvorstellungen haben und für diese selbstbewusst eintreten, und dass für deren Walten und Wirken pragmatische Lösungen bereithält. Und es hat die in der Revision aufgeworfenen Sachfragen nicht lediglich als passagères Phänomen der Migration oder Integration verbucht, sondern ebenso nüchtern wie zutreffend als ernsthafte Anfragen an das Staatskirchenrecht verstanden und gelöst.
Für die klagenden Verbände bedeutet das Urteil des BVerwG in erster Linie, dass sie nach langen Jahren die an sie gestellten verfassungsrechtlichen Anforderungen kennen. Der Staat ist für sie ein verlässlicher Partner geworden.