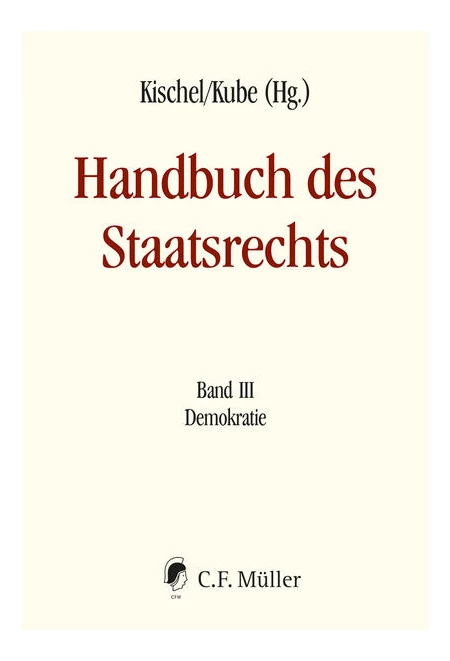Emanuel V. Towfigh, Parteikonzeptionen im Rechtsvergleich, in: Kischel/Kube (Hg.), Handbuch des Staatsrechts, Band 3, 2025
In der dritten Band des Handbuchs des Staatsrechts reflektiert Prof. Dr. Emanuel V. Towfigh unter § 61 zu Parteikonzeptionen im Rechtsvergleich.
Zusammenfassung in Leitsätzen
- Parteien spielen eine Schlüsselrolle in modernen Staatsordnungen, sowohl in demokratischen als auch in autoritären Regimen. Sie gehören zum institutionellen Inventar staatlicher Ordnungen und sind als „Schleusen“ zwischen Staat und Gesellschaft wesentliche Faktoren konstitutioneller Gestaltung. Die jeweilige Parteikonzeption einer staatlichen Ordnung lässt sich aus ihren Funktionen ableiten und variiert in Abhängigkeit von der sie einhegenden politischen und verfassungsrechtlichen Ordnung.
- Ihre systemübergreifende, weltweite Verbreitung prädestiniert sie für eine rechtsordnungsübergreifende Betrachtung, die ihre Rolle für den Diskurs (als die organisiert-rationale Vorbereitung politischer Entscheidungen), die Politik (als die durch das staatliche Gewaltmonopol sanktionierte, verbindliche Entscheidung und ihre Kontrolle) und das Personal (verstanden als Auswahl und Überwachung der politischen Entscheidungsträger) in den Blick nimmt.
- Im Zentrum demokratischer Herrschaftsverfassungen steht die Volkssouveränität: Das staatliche Gewaltmonopol findet Ursprung und Rechtfertigung im Demos, die konstituierte Staatsgewalt muss auf diesen zurückgeführt werden können. Diese Souveränität wird von der Staatsgemeinschaft in Abstimmungen (direkte Demokratie) und in Wahlen (repräsentative Demokratie) ausgeübt. Parteien nehmen in diesen Verfahren eine wichtige Mittler-Rolle ein. Wie sie diese Rolle ausüben, hängt unter anderem davon ab, ob sie Akteure in einer parlamentarischen, präsidialen oder direkten Demokratie sind. In einer Konkordanzdemokratie agieren sie anders als in einer wettbewerblichen Ordnung.
- In der parlamentarischen Demokratie Deutschlands ist die Mittlerfunktion besonders ausgeprägt, über ihre Mitglieder sind die Parteien in der Gesellschaft verwurzelt und ihre parlamentarischen Repräsentantinnen und Repräsentanten schlagen die Brücke in die staatliche Sphäre. In der Konkordanzdemokratie der Schweiz sind die Parteien ein Akteur der Willensbildung unter mehreren, was zu einer insgesamt schwachen Stellung innerhalb der politischen Ordnung führt. Die als Wahlvorbereitungsorganisation konzipierten Parteien der USA wiederum verfügen über keine ausgeprägte Mitgliederstruktur, die Parteien nehmen daher die Mittlerfunktion vor allem vermittelt durch die ihnen zuzurechnenden Abgeordneten wahr. Einzig die Parteikonzeption der EU überantwortet ihren Parteien noch weniger Einflussmöglichkeiten. Die Konstruktion der europäischen Parteien als Dachverbände, die fehlenden Individualmitglieder und ihre Abhängigkeit von ihren nationalen Mitgliedsparteien lassen es kaum zu, eine effektive Mittlerrolle einzunehmen.
- In den nicht-demokratischen Herrschaftsverfassungen der DDR und Chinas ist „Herrschaft durch Partei“ die ideologische Legitimationsbasis staatlichen Handelns. Die Partei übernimmt in diesen ideologisch determinierten Parteistaaten als zentralisiert-hierarchische Organisation die Führungsrolle in sämtlichen Gewalten des Staates, in Gesellschaft und Wirtschaft, und hat in all diesen Bereichen die alleinige Entscheidungsmacht. Einer Aggregation verschiedener Interessen als Wettbewerb von Meinungen zur Ermittlung eines Gemeinwillens, bedarf es in diesen Ordnungen nicht; der Gemeinwille wird durch eine elitäre Parteidoktrin substituiert, die paternalistisch für sich in Anspruch nimmt, kraft überlegener Vernunft die Bedürfnisse der Einzelnen und der Gemeinschaft in Einklang zu bringen.
- Das Konzept „Partei“ ist seinem Wesen nach Herrschaftsinstrument. In demokratischen Herrschaftsverfassungen wird dieses Herrschaftsinstrument durch liberal-demokratische Grundprinzipien wie Wahlen, eine Garantie der Parteienpluralität und das Gebot demokratischer Binnenstrukturen eingehegt und demokratisiert. Es findet sich in einem Spannungsfeld zwischen der Vermittlung demokratischer Legitimation durch die Inklusion möglichst vieler Interessen einerseits und ihrer eigentlichen Herrschaftsfunktion andererseits wieder, der ein „Sog“ zur Oligopolisierung und Monopolisierung immanent ist. Die demokrati-schen Parteikonzeptionen auf der einen und die autoritären Parteikonzeptionen auf der anderen Seite können also als zwei Enden eines Spektrums von Parteikonzeptionen verstanden werden.
- Autoritär-populistische Parteien nutzen dieses Spannungsfeld aus, indem sie Demokratie und „Systemparteien“ durch eine unredliche Verquickung der (nicht abwegigen) Kritik an den beiden Polen des Spannungsfeldes mit dem Vorwurf angreifen, gleichzeitig ineffektiv und undemokratisch zu sein. Die Parteien finden sich dadurch in einer Zwickmühle wieder, in der der demokratische Parteienstaat eigentlich nur verlieren kann. Es fehlt an in den Parteikonzeptionen unmittelbar angelegten Schutzmechanismen, die verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegengesetzt werden können. Demokratische Ordnungen sind auf die Wehrhaftigkeit der Grundprinzipien des demokratischen Verfassungsstaats angewiesen, die ihre Schutzwirkung aber nur so lange entfalten können, wie der Konsens über ihre Unantastbarkeit nicht – etwa von Populisten – aufgekündigt wird.