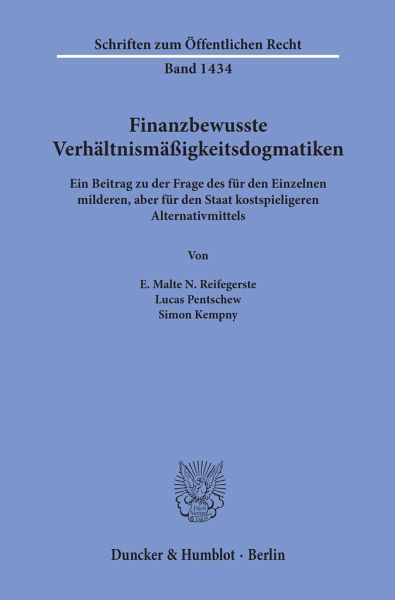Rezension zu
E. Malte N. Reifegerste/Lucas Pentschew/Simon Kempny, Finanzbewusste Verhältnismäßigkeitsdogmatiken. Ein Beitrag zu der Frage des für den Einzelnen milderen, aber für den Staat kostspieligeren Alternativmittels, Berlin 2020 (Duncker & Humblot), Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 1434, 164 Seiten
in: Niedersächsische Verwaltungsblätter (NdsVBI.) 2021 (Heft 12), S. 387-388 (PDF)
Seit etwas mehr als einem Jahr ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in aller Munde, zeitweilig entstand der Eindruck, die Deutschen seien ein Volk von Rechtswissenschaftler:innen, so leidenschaftlich wurde über die Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen diskutiert und gestritten. Der Grund für diese Popularität war die Corona-Pandemie, die nicht nur der Rechtswissenschaft viel abverlangte. Man könnte also meinen, die angezeigte Monographie sei Folge des breiten Interesses an dieser dogmatischen Figur. Allerdings war für die Autoren nicht die Pandemie Ansporn, der umfassenden Dogmatik zu dieser Rechtsfigur eine weitere Dimension hinzufügen zu wollen; vielmehr war es ausweislich des Vorworts eine alltägliche Beobachtung im Straßenverkehr, welche die Autoren dazu inspirierte, sich der Frage des Einflusses von Kostenersparnissen auf die Abwägungsentscheidung im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu widmen.
Ergebnis dieser Überlegungen ist ein etwa 150-seitiger Text, der der Frage nachgeht, ob die klassische Definition des Merkmals der Erforderlichkeit einer Maßnahme auch dann zu tragfähigen Ergebnissen gelangt, wenn das den Grundrechtsberechtigten weniger belastende Mittel für den Staat teurer wird. Die Verfasser versprechen ihren Leser:innen eine „schlankere Dogmatik“, die die entscheidenden Wertungsfragen offenlege und rationalisiere (S. 113).
Ausgehend von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, welches teurere aber freiheitsschonendere Alternativen in der Regel ablehnt, beschäftigen sich die Verfasser zunächst mit der Frage nach dem rechtlichen Wert der Vermeidung von Mehrkosten – nur wenn der Vermeidung von Mehrkosten eigenständige rechtliche Bedeutung beigemessen werden könne, könne sie im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Rolle spielen und intensivere Freiheitseingriffe rechtfertigen. Hierzu stellen die Verfasser ausführlich verschiedene Begründungen aus der Literatur – namentlich von Andreas von Arnauld[1], Laura Clérico[2] und Thomas Wischmeyer[3] – vor, die im Ergebnis die Legitimität von Freiheitseingriffen zur Vermeidung finanzieller Mehrkosten bejahten (Abschnitt B, S. 15–39).
Nach Klärung dieser Vorfrage unterziehen die Verfasser im sich anschließenden Abschnitt (C, S. 40–112) die verschiedenen in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansätze zur Behandlung des Problems eines freiheitsschonenderen, aber teureren Alternativmittels einer eingehenden Prüfung. Hierzu exerzieren sie diese Ansätze anhand eines Beispielfalls durch. In Abwandlung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Liquor-Entnahme (BVerfGE 16, 196) wird unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien die Verhältnismäßigkeit des § 81a Abs. 1a StPO untersucht: § 81a Abs. 1a StPO sieht zur Feststellung der Schuldfähigkeit die Möglichkeit einer Liquor-Entnahme mittels Lumbalpunktion vor; medizinisch möglich und für den Patienten mit weniger Nebenwirkungen verbunden wäre aber auch eine Okzipitalpunktion – die aber teurer ist als eine Lumbalpunktion. Die verschiedenen Szenarien betreffen Varianten bezüglich der Zahl der durchgeführten Liquor-Entnahmen, der Mehrkosten und der Situation des Staatshaushaltes. Die Verfasser gelangen zu dem Ergebnis, dass es der Rechtsprechung an einem nachvollziehbaren Maßstab mangele, mit dessen Hilfe sich die Frage nach der Erforderlichkeit einer mit Mehrkosten verbundenen Maßnahmen beantworten ließe. Auch seien die Kriterien nicht transparent, die der Abwägung zwischen den Mehrkosten einer Maßnahme und dem Freiheitsgewinn der Grundrechtsberechtigten zugrunde gelegt würden. Das Bundesverfassungsgericht spreche Alternativmitteln die Gleicheignung ab, wenn sie das „vernünftigerweise von der Gesellschaft erwartbare Maß übersteigen“.[4] Den zugrundeliegenden Abwägungsprozess lege das BVerfG hingegen nicht dar. Es treffe somit eine reine Wertungsentscheidung, die nicht nachvollziehbar sei.
Auch die rechtswissenschaftliche Literatur offenbare Schwächen, etwa die von Rainer Dechsling[5] im Wege einer Modifikation des Kaldor-Hicks-Kriteriums vorgenommene Kosten-Nutzen-Abwägung, die Wertungsfragen nicht nur auf die Ebene der Erforderlichkeit vorverlagere, sondern im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit eine erneute Abwägung erfordere. Der Kaldor-Hicks’sche Gedanke der Kompensation von Nachteilen erfordere darüber hinaus eine Monetarisierung von Grundrechtseingriffen, die häufig nicht möglich sei. Dass sich auch nach dem Ansatz von Andreas von Arnauld die Kosten-Nutzen-Frage bereits im Rahmen der Erforderlichkeit stelle, führe letztlich zu einer inzidenten Verhältnismäßigkeitsprüfung, die nötig werde, um bestimmen zu können, welches das „mildere“ Mittel sei: Die Belastung der Allgemeinheit zugunsten des Einzelnen sei dann milderes Mittel, wenn die Belastung des Einzelnen zum Zwecke der Entlastung der Allgemeinheit unverhältnismäßig wäre. Thomas Wischmeyer klammere in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts finanzwirksame Alternativen bei der Suche nach einem milderen Mittel völlig aus und nehme gerade keine Abwägung zwischen Kosten und Freiheit vor. Die Zweck-Mittel-Relation sei nicht im Hinblick auf einen Vergleich verschiedener Mittel untereinander, sondern lediglich bezüglich des untersuchten Mittels zu betrachten. Teurere Alternativmittel werden so gar nicht berücksichtigt, für den Fall stärkerer Freiheitseinbußen seien Kompensationsmechanismen vorzusehen.
Diesen Lösungsansätzen – die den Verfassern zufolge entweder intransparent sind, Wertungsgesichtspunkte nicht offenlegen, die verschiedenen Wertungsebenen vermengen oder zu nicht konsensfähigen Abwägungsergebnissen kommen – soll nun eine „sparsame Verhältnismäßigkeitsdogmatik“ (S. 113) mit klareren Strukturen entgegensetzt werden. Anders als die vorgestellten anderen Auffassungen setzen die Verfasser dafür bereits im Rahmen des legitimen Zweckes einen Schwerpunkt, indem sie herausstellen, dass es verschiedene legitime Zwecke geben kann, die sich auf die Zweck-Mittel-Relation auswirken. So sei im Beispielsfall die Strafrechtspflege der Hauptzweck, während die Kostenvermeidung einen Nebenzweck darstellen könne.
Den Schwerpunkt ihrer Überlegungen verschieben die Verfasser in die Prüfung der Angemessenheit, nachdem sie im Rahmen der Erforderlichkeit konstatieren, dass das gewählte Mittel bereits dann erforderlich sei, wenn nur irgendein Zweck durch das Alternativmittel weniger gefördert würde. Ist also das Alternativmittel teurer, so ist das gewählte Mittel erforderlich, da der Kostenvermeidungszweck nicht gefördert werde. Im Rahmen der Zweck-Mittel-Relation führt dies zu der Abwägung, ob die konkrete geringere Haushaltsbelastung die konkrete größere Freiheitseinbuße wert ist. Dies lasse sich nur beurteilen, wenn die Differenz zwischen (eingriffsintensiverer) Freiheitseinbuße, die das gewählte (kostengünstigere) Mittel erzeugt, und (eingriffsgünstigerer) Freiheitseinbuße, die das (kostenintensivere) Alternativmittel verursacht, in die Abwägung einbezogen werde.
Dies wollen die Verfasser durch eine „zweiphasige Prüfung“ (S. 120) erreichen: In einem ersten Schritt werden Hauptzweck – im Beispiel: die Strafrechtspflege – und Mittel – im Beispiel: Lumbalpunktion und Okzipitalpunktion – ins Verhältnis gesetzt; beide Maßnahmen sind mit Blick auf diesen Zweck geeignet. Im zweiten Schritt werden dann die durch das gewählte Mittel – hier: die Lumbalpunktion – erzeugten geringeren Kosten ins Verhältnis zur im Vergleich zum Alternativmittel – hier: Okzipitalpunktion – größeren Freiheitseinbuße gesetzt. Wenn diese beiden Abwägungen das „zu tolerierende Maß“ wahrten (S. 122), sei das gewählte Mittel angemessen und damit verhältnismäßig.
Schon diese komplizierten Ausführungen zeigen: Letztlich wird das Werk dem selbstgesetzten Anspruch nicht gerecht, eine „schlankere“ und „sparsame Verhältnismäßigkeitsdogmatik“ mit klareren Strukturen zu präsentieren, die die entscheidenden Wertungsfragen transparent macht und rationalisiert (S. 113).
Das Werk mag als Einführung in den Streitstand dienen, der eigene Lösungsvorschlag hingegen misslingt; die – oft zutreffende – Kritik an der Vagheit und Wertungsoffenheit der anderen Ansätze muss er sich genauso gefallen lassen. Die Frage der Autoren, wann das „zu tolerierende Maß überschritten“ ist, lässt sich nicht leichter beantworten als die Frage des (wortreich gescholtenen, S. 62) Bundesverfassungsgerichts, wann eine Maßnahme das „vernünftigerweise von der Gesellschaft erwartbare Maß übersteigt“. Denn die Fragen sind von ihrer leicht divergenten Formulierung abgesehen identisch. Vielleicht bleiben die Verfasser bei der Darstellung ihrer eigenen Position deshalb oft mutlos im Vagen: So lassen sie offen, zu welchem Ergebnis sie bei der Anwendung ihres eigenen Maßstabes in den von ihnen gebildeten Fallvarianten gelangen würden – sie beantworten also die Frage nicht, wann im Beispielsfall das „zu tolerierende Maß“ nicht mehr gewahrt ist. Die Unterschiede des neu entwickelten Ansatzes der Autoren zu Ansätzen in Rechtsprechung und rechtswissenschaftlicher Literatur bleiben damit unklar. Während die bisher entwickelten Konzeptionen aus Rechtsprechung und Literatur im Abschnitt C übersichtlich dargestellt und die Beispielsfälle nachvollziehbar unter diese subsumiert werden, kommt die „Prüfung“ des eigenen Ansatzes in Abschnitt D kompliziert und unübersichtlich daher. „Definitionen“, die u.a. die unterschiedlichen Ansätze griffig gegeneinander abgrenzbar machen, finden sich nicht. Der Text ist einerseits eigenartig theoriefern und andererseits unnötig kompliziert geschrieben.
In formeller Hinsicht fällt auf, dass die Autoren insbesondere die Ausführungen zu ihrem eigenen Ansatz mit zahlreichen Einschüben spicken, welche die Lesbarkeit erheblich erschweren. Sie beziehen sich dabei auf die bei Einführung ihres Ansatzes eingesetzten Tabellen und Grafiken, deren Nutzen sich allerdings weder bei der Einführung noch bei der späteren Inbezugnahme erschließt. Jedenfalls tragen weder Tabellen noch Grafiken dazu bei, die Gedankengänge der Verfasser besser nachvollziehen zu können. Anstelle der miteinander abzuwägenden Begriffe „Freiheitseingriff“ und „Kostenersparnis“ bilden die Verfasser eine Zweck-Mittel-Relation „60 Freiheitseinbuße“ zu „50 Kostenersparnis“ — und lassen Leser:innen dann mit dieser Information praktisch allein. Dies verwundert, da sie unmittelbar zuvor vollmundig versprechen, dass sich der Vorteil ihrer zweistufigen Abwägung bereits bei einer rein „versprachlichten Vorgehensweise“ zeige – eine schematisch-mathematische Abwägung sei nicht erforderlich (S. 135).
Dem Lesefluss nicht zuträglich sind insgesamt die teilweise sehr langen Fußnoten mit inhaltlichen Ausführungen, die bisweilen fast eine ganze Seite füllen.[6] Exemplarisch sei hier Fußnote 5 genannt: Sie soll die nach der zutreffenden Einschätzung der Autoren für die Monographie wesentlichen (!) Aspekte der Verhältnismäßigkeitsdoktrin knapp darstellen, verliert die Leser:innen aber schon nach den ersten fünf Worten mit mehrfachen Einschüben. Es gibt keinen Grund, diesen Aspekten der Verhältnismäßigkeitsdoktrin nicht den ihnen gebührenden Platz im Haupttext einzuräumen. Ähnliches muten die Autoren ihren Leser:innen in den Fußnoten 147 und 469 zu.
Dass die Verfasser dem Impuls nicht widerstehen konnten, mit dem Nachtrag aus Anlass der Corona-Pandemie ihre Ausführungen mit einer aktuellen Fragestellung zu verknüpfen, ist nachvollziehbar: Selten zuvor wurde die Frage nach der Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen so intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert und bewertet. Der Mehrwert dieser Ausführungen ist allerdings gering. Dies liegt unter anderem daran, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt aufgrund der zum Entstehungszeitpunkt des Bandes (April/Mai 2020) noch vergleichsweise unklaren Faktenlage stark vereinfacht wurde und so eine Klarheit vorgibt, die der tatsächlichen Komplexität der Situation nicht gerecht werden konnte. Damit ringen die Verfasser spürbar, wenn sie versuchen, aus der Fülle der möglichen legitimen Zwecke für Ausgangssperren die für die Abwägung entscheidenden auszuwählen und anzuwenden. Auch hier formulieren die Autoren keine Ergebnisse, so dass die Ausführungen blutleer bleiben und für die Praxis keine Relevanz zu entfalten vermögen.
So bleibt zum Schluss die wenig überraschende Einsicht, dass eine „freiheitsbewusste Verhältnismäßigkeitsdogmatik“ wesentlich von der Antwort auf die Frage abhängt, ob die Kostenvermeidung die Freiheitsbegrenzungen wert ist (S. 153). Das ist für eine mit großen Ambitionen angelegte, sich als dogmatische Schärfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes präsentierende Monographie dann doch etwas zu „schlank“.
Emanuel V. Towfigh, Wiesbaden
[1] Arnauld, Andreas von, Die Freiheitsrechte und ihre Schranken.
[2] Clérico, Laura, Die Struktur der Verhältnismäßigkeit.
[3] Wischmeyer, Thomas, Die Kosten der Freiheit. Grundrechtsschutz und Haushaltsautonomie.
[4] BVerfG, Beschl. V. 6.10.1987, 1 BvR 1086, 1468, 1623/82, BVerfGE 77, 84, 110 (Arbeitnehmerüberlassung).
[5] Dechsling, Rainer, Das Verhältnismäßigkeitsgebot. Eine Bestandsaufnahme der Literatur zu Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns.
[6] Vgl. zu dieser Unart, Fußnoten mit Detailwissen zu füllen Sarah Praunsmändel, Unterbrochene Verweiskette: Eine Glosse über die rechtswissenschaftliche Verweispraxis, VerfBlog, 2021/7/26, https://verfassungsblog.de/unterbrochene-verweiskette/, DOI: 10.17176/20210726-140120-0 (zuletzt abgerufen am 12. August 2021).